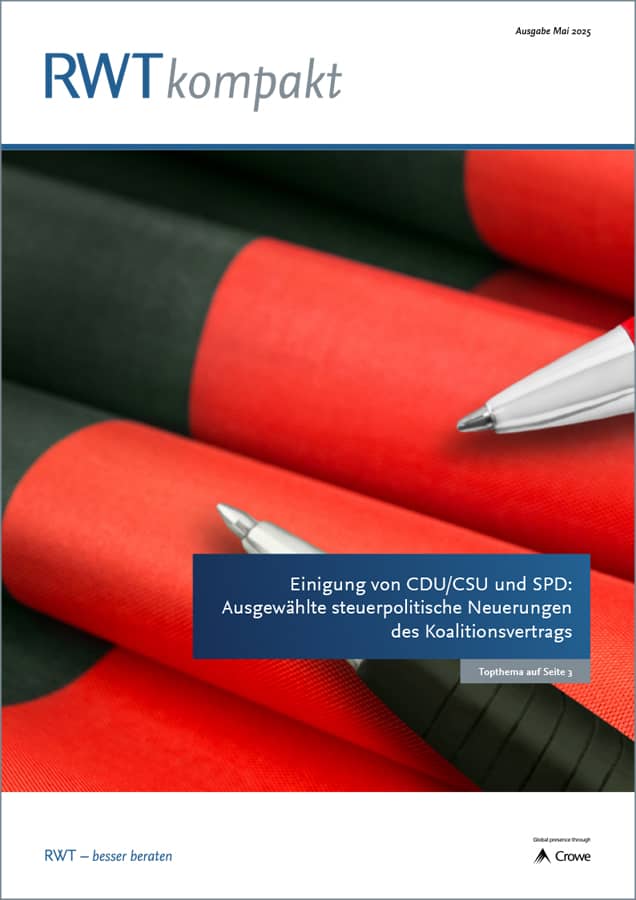Einigung von CDU/CSU und SPD: Ausgewählte steuerpolitische Neuerungen des Koalitionsvertrags
Die CDU/CSU und die SPD haben am 9. April 2025 den Koalitionsvertragsentwurf veröffentlicht. In diesem einigen Sie sich auch auf umfangreiche steuerliche Neuerungen. Der vorgelegte Koalitionsvertragsentwurf geht dabei im steuerlichen Bereich zum Teil über die im Sondierungspapier vom 8. März 2025 veröffentlichten Vorhaben hinaus. Für Unternehmen besonders hervorzuheben ist die Senkung des Körperschaftsteuersatzes sowie die Einführung einer degressiven AfA.
Die schnelle Einigung der Parteien rund vier Wochen nach der Veröffentlichung der Sondierungspapiere ist vermutlich auf den Einigungsdruck aufgrund der wirtschaftspolitischen Lage zurückzuführen. Das aktuelle weltpolitische Geschehen, so unter anderem auch die amerikanische Zollpolitik, scheinen dabei den Druck zusätzlich erhöht zu haben.
Die folgenden steuerlichen Vorhaben wurden von den Parteien vereinbart:
Unternehmenssteuern und Investitionen
- Einführung einer degressiven AfA von 30 % auf „Ausrüstungsinvestitionen“ für die Jahre 2025, 2026 und 2027 (Investitions-Booster)
- Senkung des Körperschaftsteuersatzes von derzeit 15 % in fünf Schritten um 1 Prozentpunkt jährlich ab 2028
- Verbesserung des Optionsmodells (§ 1a KStG) und der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG) für Personengesellschaften
- Prüfung, ob gewerbliche Einkünfte neu gegründeter Unternehmen unabhängig von der Rechtsform unter die Körperschaftsteuer fallen können.
- Einsatz für eine in der EU einheitliche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer
- Festhalten an der globalen Mindeststeuer. Einsatz auf europäischer Ebene, dass daraus keine Benachteiligung für Unternehmen im internationalen Wettbewerb entstehen
- Unterstützung einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene
Gewerbesteuer
- Erhöhung des Mindesthebesatzes von 200 % auf 280 %
- Maßnahmen gegen „Scheinsitzverlegungen in Gewerbesteueroasen“
Umsatzsteuer
- Steuersatz von dauerhaft 7 % für Speisen in der Gastronomie zum 1. Januar 2026
- Umstellung der Einfuhrumsatzsteuer auf ein Verrechnungsmodell
Einkommensteuer
- Senkung des ESt-Tarifs für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislaturperiode – Eckwerte unbekannt
- Erhöhung der Pendlerpauschale, ab 1. Januar 2026 gelten 38 Cent ab dem 1. Kilometer und zwar dauerhaft
- Aktivrente steuerfrei – Gehälter bis 2.000 Euro/Monat für Arbeitnehmer, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben und freiwillig weiterarbeiten
- Beibehaltung des Solidaritätszuschlags
- Attraktive steuerliche Anreize für die Mitgliedschaft in Gewerkschaften
- Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen, die über die tariflich vereinbarte beziehungsweise an Tarifverträgen orientierte Vollzeitarbeit hinausgehen
- Steuerliche Begünstigung für vom Arbeitgeber an Arbeitnehmer gezahlte Prämien zur dauerhaften Ausweitung der Arbeitszeit von Teilzeit auf an Tarifverträgen orientierte Vollzeit
- Bei Erhöhung der Kinderfreibeträge soll das Kindergeld adäquat angehoben werden
- Anhebung oder Weiterentwicklung des Alleinerziehenden-Entlastungsbetrags
Förderung der Elektromobilität
- Erhöhung der Bruttopreisgrenze bei E-Fahrzeugen auf 100.000 Euro bezüglich der steuerlichen Begünstigung von Dienstwagen (0,25 %-Regelung)
- Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge
- Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis zum Jahr 2035
- Förderung von Plug-In-Hybrid-Technologie (PHEVs) und Elektrofahrzeugen mit Range-Extender (EREV) und entsprechende Regulierung auf europäischer Ebene
- Befreiung emissionsfreier LKWs von der Mautpflicht über das Jahr 2026 hinaus
Forschung, Energie und öffentliche Hand
- Forschungszulage: deutliche Anhebung des Fördersatzes und der Bemessungsgrundlage
- Senkung der Stromsteuer auf europäisches Mindestmaß – schnelle Entlastungen um mindestens 5 Cent pro kWh
- Reduzierung der Übertragungsnetzentgelte
- Anpassung des steuerlichen Rechtsrahmens für den Querverbund zur Sicherung des Fortbestands der kommunalen Daseinsvorsorge
Ehrenamt und Gemeinnützigkeit
- Anhebung der Übungsleiterpauschale auf 3.300 Euro und der Ehrenamtspauschale auf 960 Euro
- Erhöhung der Freigrenze aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb für gemeinnützige Vereine auf 50.000 Euro
- Modernisierung des Katalogs der gemeinnützigen Zwecke
- Ausnahme vom Erfordernis der zeitnahen Mittelverwendung für gemeinnützige Organisationen mit Einnahmen bis 100.000 Euro
- Keine Sphärenaufteilung auf Zweckbetrieb und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb für gemeinnützige Körperschaften mit Einnahmen von weniger als 50.000 Euro im Jahr
Bürokratieabbau in der Steuerverwaltung
- Digitalisierung der Finanzverwaltung und Einsatz von künstlicher Intelligenz
- Steuervereinfachung durch Typisierungen, Vereinfachungen und Pauschalierungen
- Schrittweise Verpflichtung zur Abgabe von digitalen Steuererklärungen
- Ausweitung der automatisierten und vorausgefüllten Steuererklärungen für einfache Steuerfälle
- Zielsetzung: Das Umstellen von Körperschaften und Personengesellschaften auf Selbstveranlagung
Vermeidung von Steuerhinterziehung
- Prüfung gesetzlicher Maßnahmen, beispielsweise Überprüfung von Registrierkassenpflichten, Steueroasen und Telefonüberwachung bei bandenmäßiger Steuerhinterziehung
- Prüfung weiterer Maßnahmen zur Vermeidung von Cum/Cum-Geschäften
Während die Abstimmungsberechtigten der CSU ihre Zustimmung bereits erteilt haben, steht das Votum der CDU und der SPD noch aus. Bei Zustimmung der Parteien zum Koalitionsvertrag soll die Kanzlerwahl am 6. Mai 2025 stattfinden. Nach der Kanzlerwahl dürfte zeitnah auch die Vereidigung der Minister erfolgen. Das Bundefinanzministerium geht dabei an die SPD.
Zu berücksichtigen ist, dass die im Koalitionsvertrag angekündigten steuerpolitischen Maßnahmen der Zustimmung des Bundesrats bedürfen. Dort verfügen Union und SPD nicht über die Mehrheit. Insbesondere hinsichtlich der geplanten Steuersenkungen, soweit sie Auswirkung auf die Steuereinnahmen der Länder haben, könnte dies kritisch werden. Zudem stehen die Maßnahmen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Das heißt steuerpolitische Maßnahmen werden erst nach der Aufstellung des Haushalts umgesetzt. Der finanzielle Spielraum nach dem „Kassensturz“ wird als überschaubar eingeschätzt.
RWTkompakt Ausgabe Mai 2025