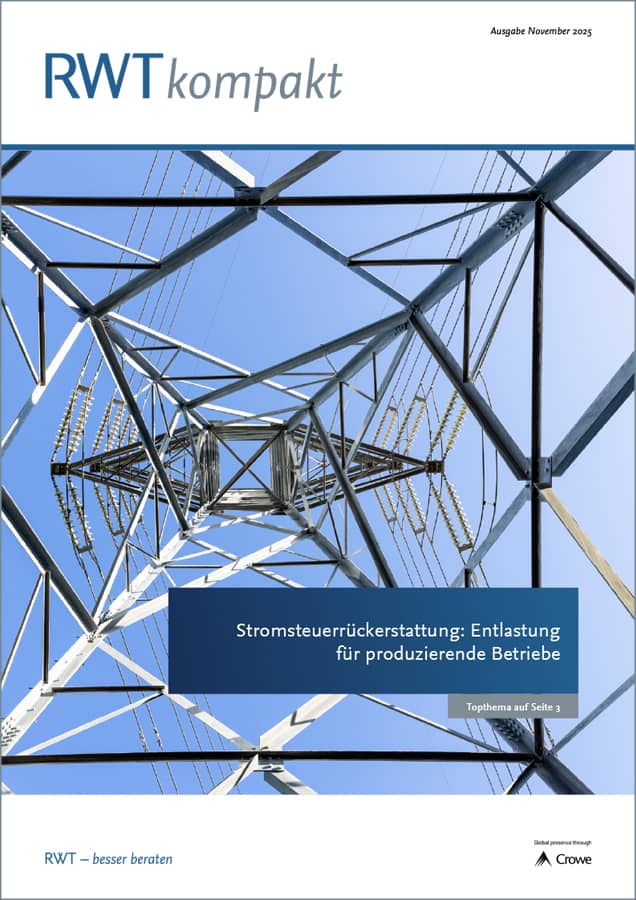Einführung des Stiftungsregisters: Ein Schritt zu mehr Transparenz
In den vergangenen Jahren wurde immer wieder der Wunsch nach größerer Transparenz im Bereich der Stiftungen geäußert. Mit der Einführung eines bundesweiten, zentralen Stiftungsregisters zum 1. Januar 2026 wird dieses Anliegen nun umgesetzt. Ziel des Registers ist es, zentrale Informationen über Stiftungen öffentlich zugänglich zu gestalten, um die Strukturen und Tätigkeiten von Stiftungen nachvollziehbarer zu machen. Ein bedeutender Fortschritt für Kontrolle und Vertrauen im gemeinnützigen Bereich.
Zweck des Stiftungsregisters
Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts gelten als juristische Personen und entstehen durch die Stiftungsgründung sowie die anschließende Anerkennung. Für ihre Errichtung ist eine Stiftungssatzung erforderlich, in der unter anderem der Stiftungszweck, das Vermögen sowie die organisatorische Struktur festgelegt werden.
Bisher führen die Stiftungsaufsichtsbehörden Stiftungsverzeichnisse mit bestimmten Informationen der Stiftungen, wie Name, Sitz und Anschrift. Da es jedoch kein zentrales Register gab, mussten sich die Beteiligten im Rechtsverkehr mit sogenannten Vertretungsbescheinigungen der Stiftungsbehörden behelfen, durch die sich die Stiftungsorgane im Rechtsverkehr mit begrenzter Rechtsscheinwirkung als Vertreter der Stiftung legitimieren konnten.
Mit der Einführung des elektronischen Stiftungsregisters, das vom Bundesamt für Justiz geführt wird, soll nunmehr die Transparenz für Stiftungen erhöht werden. Insbesondere wird dadurch der Nachweis der Vertretungsberechtigung der Mitglieder des Vorstands, ihrer besonderen Vertreter und ihrer Liquidatoren erleichtert. Das neue Register ersetzt allerdings nicht das bestehende Anerkennungsverfahren bei den Stiftungsaufsichtsbehörden, sondern ergänzt dieses lediglich um das deklaratorische Bundesstiftungsregister.
Ab dem 1. Januar 2026 müssen alle rechtsfähigen Stiftungen in das Stiftungsregister eingetragen werden. Die Einzelheiten werden durch das Stiftungsregistergesetz (StiftRG) geregelt.
Eintragungsverfahren
Die eintragungspflichtigen Angaben sind im neuen § 2 des StiftRG festgelegt. Sie umfassen unter anderem Daten wie den Namen, den Sitz und das Anerkennungsdatum der Stiftung sowie personenbezogene Informationen der Vorstandsmitglieder und -vertreter, darunter Name, Geburtsdatum, Wohnort und deren Vertretungsbefugnis.
Nach § 3 des StiftRG bedürfen Anmeldungen zur Eintragung von eintragungspflichtigen Tatsachen der öffentlichen Beglaubigung und haben durch den jeweiligen Stiftungsvorstand zu erfolgen. Die Anerkennungsentscheidung und die Satzung sowie die Dokumente über die Bestellung der Vorstandsmitglieder und der vertretungsberechtigten Vertreter sind der Anmeldung als Abschriften beizufügen (§ 82b BGB n.F.).
Bestehende Stiftungen, die vor dem 1. Januar 2026 entstanden sind, müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2026 zur Eintragung in das Stiftungsregister angemeldet werden. Nach dem 31. Dezember 2026 haben die zuständigen Behörden eine Liste der bestehenden rechtsfähigen Stiftungen an die Registerbehörde zu übermitteln. Sollte eine Stiftung bis dahin nicht eingetragen sein, droht ein Zwangsgeld in Höhe von bis zu 1.000 Euro (§ 14 StiftRG).
Rechtsfolgen der Eintragung
Mit der Eintragung rechtsfähiger Stiftungen in das Stiftungsregister erhalten diese gemäß § 82c Satz 1 BGB den Zusatz „eingetragene Stiftung“, der auch mit „e. S.“ abgekürzt werden kann. Verbrauchsstiftungen, die als solche anerkannt sind, sollen den Zusatz „eingetragene Verbrauchsstiftung“ führen, wofür die Abkürzung „e. VS“ vorgesehen ist.
Die Eintragung einer Stiftung in das Stiftungsregister entfaltet jedoch keine rechtsbegründende (konstitutive), sondern lediglich rechtsbekundende (deklaratorische) Wirkung. Das bedeutet, dass die Rechtsfähigkeit einer Stiftung nicht durch die Registereintragung entsteht, sondern weiterhin die Anerkennung durch die zuständige Stiftungsbehörde vorausgesetzt wird (§ 80 Abs. 2 BGB). Gleiches gilt für Änderungen der stiftungsrechtlichen Grundlagen – etwa des Stiftungszwecks oder der Satzung. Auch diese werden erst mit der Genehmigung durch die Stiftungsbehörde wirksam.
Einsichtnahme
Nach § 15 Satz 1 des neuen StiftRG darf jede Person Einsicht in das Stiftungsregister nehmen. Ein besonderes Interesse muss dafür nicht nachgewiesen werden. Für die beim Register eingereichten Unterlagen, wie etwa die Anerkennungsurkunde, die Satzung oder Beschlüsse zur Bestellung von Vorstandsmitgliedern, soll gemäß § 15 Satz 2 StiftRG grundsätzlich dasselbe gelten. Allerdings kann die Einsicht in bestimmte Dokumente oder Inhalte ausgeschlossen werden, wenn ein berechtigtes Interesse der Stiftung oder Dritter an der Geheimhaltung besteht – etwa zum Schutz personenbezogener Daten von Destinatären oder Stiftern oder sensibler Informationen zur Vermögensverwaltung.
Die Eintragung im Stiftungsregister ist demnach ein wichtiger Schritt zur offiziellen Anerkennung einer Stiftung. Dabei sind zahlreiche formale und inhaltliche Kriterien zu beachten, um eine reibungslose Eintragung zu gewährleisten.
Wir beraten Sie gerne bei der Eintragung Ihrer Stiftung in das Stiftungsregister und unterstützen bei der Durchführung des Registerverfahrens.
RWTkompakt Ausgabe November 2025